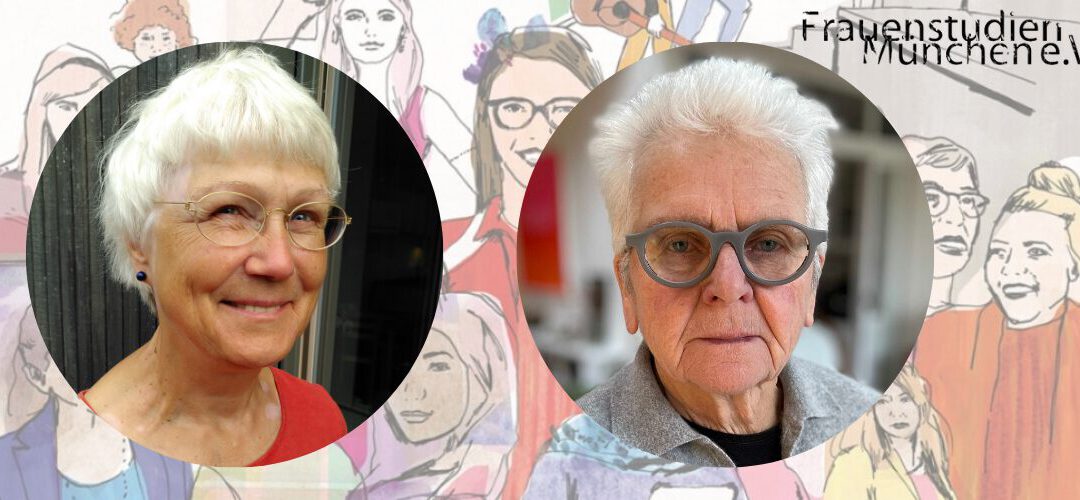Frauenstudien München gibt es nunmehr seit über 30 Jahren. Doch wie hat eigentlich alles angefangen? Wie kam es zur Idee für Frauenstudien München? Dazu hat unsere Ehrenpräsidentin Cornelia Roth 2024 die Mitgründerin von Frauenstudien München, Helga Schweigert, interviewt. Lest selbst:
Cornelia Roth: Wie kam es zur ersten Gründung von Frauenstudien München?
Helga Schweigert: Heute ist es vielleicht zuerst einmal wichtig, daran zu erinnern, dass es damals kein Internet, kein Wikipedia, kein WhatsApp oder sonstige digitale Kommunikationsmedien gab.
Cornelia: Und wann war das jetzt genau?
Helga: Das war 1980. München hatte eine lebendige autonome Frauenbewegung. Es gab bereits das Frauenzentrum in der Gabelsbergerstraße, Lillemor’s Frauenbuchladen in der Arcisstraße, die Frauenkneipe in der Schmellerstraße, den Verlag Frauenoffensive in der Kellerstraße und viele weitere Anlaufpunkte für Frauen. Ich habe noch einen lila Stadtplan, auf dem 20 Fraueninitiativen verzeichnet sind.
Cornelia: Was heißt in diesem Zusammenhang „autonom“?
Helga: So bezeichneten sich feministische Initiativen, die unabhängig von Parteien, Gewerkschaften, Vereinen, Verbänden waren, denn diese waren männlich dominiert. Selbstverständlich haben wir mit Frauen aus diesen Organisationen zusammengearbeitet, soweit sie sich für Frauenbelange emanzipatorisch eingesetzt haben.
Erster Schritt: Idee zur Gründung eines „feministischen Colleges“
Cornelia: Frauenstudien waren also noch nicht auf diesem lila Stadtplan. Wie entstand die Idee dazu?
Helga: Ich habe damals an der Münchner Frauenzeitung mitgearbeitet. Inzwischen wussten wir, dass wir nicht die erste Frauenbewegung waren, sondern es seit mindestens dem 18. Jahrhundert immer wieder Frauenbewegungen gab, die dann wieder vergessen wurden. Das sollte nicht wieder vorkommen. Wir brauchten u.a. unsere eigene Geschichtsschreibung, unser eigenes Wissen.
Cornelia: Gab es da gar nichts?
Helga: In Kalifornien hatten sich Frauen schon länger auf den Weg gemacht. Es gab die Berliner Sommerunis und in einigen Universitätsstädten außerhalb Bayerns tat sich etwas. Also startete ich in der Münchner Frauenzeitung im Juli 1980 einen Aufruf zur Gründung eines „feministischen Colleges“, wie der Arbeitstitel hieß. Dazu wollten wir uns in der Frauenkneipe treffen.
Cornelia: Was war die Resonanz auf diesen Aufruf?
Helga: Großes Interesse. Wir wollten möglichst schnell in die Gänge kommen und vereinbarten regelmäßige 14-tägige Treffen zu inhaltlichen und organisatorischen Fragen. Frauen aus der Sektion Frauenforschung in der deutschen Gesellschaft für Soziologie und aus dem Frauenforschungs-, bildungs- und -informationszentrums (FFBIZ) Berlin unterstützten uns. Am 31. August war die Vereinsgründung mit dem Namen „Frauenstudien München“. Aufgrund unserer folgenden Pressemitteilung kamen dann überraschend noch viel mehr Interessentinnen. Am 14. Oktober wurden wir ins Vereinsregister eingetragen.
Sexismus in der Sprache gehörte zu den ersten Inhalten der Arbeitskreise
Cornelia: Was waren denn die ersten Inhalte?
Helga: Die Bereiche lassen sich am besten durch die Titel der ersten Arbeitskreise zeigen: Literatur, Religion, Sprache (Sexismus in der Sprache, weibliche Sprache), Wissenschaft. Die Arbeitskreise berichteten auch immer wieder in den Plenen, um den Zugang zu ihnen offen zu gestalten.
Cornelia: Kam auch Unterstützung von außen?
Helga: Die haben wir uns geholt, indem wir ähnliche Initiativen aus der Bundesrepublik und Westberlin zu einem Vernetzungskongress Ende November bei uns einluden. Sie bekamen vorab sieben Fragen zu ihren inhaltlichen und organisatorischen Erfahrungen. Für diesen Kongress hatten wir sogar eine finanzielle Förderung vom Bundesministerium für „Jugend, Familie und Gesundheit“ der sozialliberalen Koalition.
Cornelia: Was war euer Verhältnis zu den bestehenden wissenschaftlichen Institutionen?
Helga: Wir haben uns Einführungen in die Funktion der Staatsbibliothek und des Bayerischen Hauptstaatsarchivs geben lassen. Interessanter Weise konnten sie dort mit dem Begriff „Frauenstudien“ überhaupt nichts anfangen. Wissenschaft sei doch neutral. Andererseits haben wir alle Frauen angeschrieben, die im Vorlesungsverzeichnis der LMU aufgeführt waren (etwa 10%). Leider kam keine Rückmeldung.
Frauenstudien konzentrierte sich auf den außerakademischen Bereich
Cornelia: Das heißt, den akademischen Bereich konntet ihr vergessen?
Helga: Ganz so war das nicht. Das bezog sich nur auf die Institutionen. Es gab aber eine Reihe Wissenschaftlerinnen, die mit den blinden Flecken ihres Forschungsbereiches schon länger unzufrieden waren. Nicht umsonst gründeten Wissenschaftlerinnen 1984 schließlich die Frauenakademie München. Wir konzentrierten uns jedoch auf den außerakademischen Bereich, bezogen aber Wissenschaftlerinnen mit ein.
Cornelia: Willst du mal ein Beispiel für den Ablauf eines Arbeitskreises geben?
Helga: Vielleicht den zu Anita Augspurg und Lida Gustava Heymann. Wir hatten ihre Autobiographie „Erlebtes und Erschautes“ – schon damals nicht mehr im Buchhandel erhältlich. Dazu haben wir Exkursionen ins Isartal und nach Peißenberg zu ihren darin erwähnten Wohnorten und Häusern gemacht. Es war überraschend, dass in den jeweiligen Kommunalverwaltungen und bei den neuen BesitzerInnen der Häuser durchaus ein Bewusstsein dazu bestand, wer die Erbauerinnen waren – ein Teil oral history. Zusätzlich sind wir im Bayerischen Hauptstaatsarchiv fündig geworden bei den polizeilichen Spitzelberichten über die Versammlungen, die von ihnen abgehalten wurden. Im Rückblick erschien das sogar amüsant. – Natürlich war die Vorgehensweise der einzelnen Arbeitskreise vom jeweiligen Thema bestimmt.
Cornelia: Auf eurem Briefpapier hattet ihr eine Abbildung mit zwei Evas mit ihren Äpfeln der Weisheit. Wo kam das her?
Helga: Ich war ja auch fotografisch unterwegs und entdeckte in Schwabing an einer Fassade ein Jugendstilrelief mit Adam und Eva, die sich gegenüber lagen. Bei dem Foto habe ich den Adam abgeschnitten und Eva gekontert. So gab jede Eva der anderen einen Apfel der Weisheit. Das hat für mich unser Verständnis von selbst organisierter Forschung ganz gut symbolisiert. Und etwas frech war es auch.
1988 übernahmen Helma Mirus und Erika Wisselinck den Verein Frauenstudien
Cornelia: Lief denn alles immer so ganz glatt?
Helga: Nun, natürlich nicht. Die Münchner Frauenzeitung erschien ab 1981 nicht mehr. Das war ein wichtiges Kommunikationsmedium für uns. Später brach uns dann auch noch die Frauenkneipe als Versammlungsort weg. Die Arbeitskreise verlangten viel Kraft und Zeit von den Teilnehmerinnen, die ja in der Regel auch berufstätig waren. Wir probierten andere Orte und Angebotsformen, wie Vorträge und Arbeitsberichte.
Cornelia: Wen hattet ihr so eingeladen?
Helga: Kurzes name-dropping? Heide Göttner-Abendroth, Lerke Gravenhorst, Lising Pagenstecher, Christa Reinig, Ilona Ostner, Erika Wisselinck, Anita Heiliger, etc. Leider liegen mir die Programme nicht mehr vor, denn ich habe meinen Teil an das Forum Queeres Archiv München gegeben. Übrigens ist aus Anita Heiligers Vortrag später das Projekt Kofra geworden.
Cornelia: Erika Wisselinck! Wie kamt ihr auf sie?
Helga: Nun, ich kannte sie schon aus den 60er Jahren von der Evangelischen Akademie Tutzing und später immer wieder in neuen Zusammenhängen. Sie hatte gerade für den Verlag Frauenoffensive Mary Daly, Gyn/Ökologie, übersetzt und uns gezeigt, welche kreative Spracharbeit dahinter steckte. Sie hat in der Folge noch mehr von Mary Daly übersetzt und schließlich selbst ein Buch geschrieben mit dem Titel „Frauen denken anders“. Das Cover zeigte eine stilisierte Eule.
Cornelia: Erika Wisselinck hat ja dann Frauenstudien von euch übernommen.
Helga: Ja, 1988. Wir hingen etwas in den Seilen. Wir hatten zwar längst die Gemeinnützigkeit zugesprochen bekommen und konnten unsere Veranstaltungen im Frauenkulturhaus in der Richard-Strauss-Straße abhalten. Dieses Frauenkulturhaus war mit Unterstützung von Friedel Schreyögg und der Gleichstellungsstelle von der Stadt gefördert. Was notwendig gewesen wäre: es fehlte ein regelrechtes Büro und auch das entsprechende „Personal“. Da kam Erika auf uns zu und fragte uns, ob einverstanden wären, wenn sie den Verein übernehmen würde. Das war uns sehr recht, auch wenn wir wussten, dass das auch eine konzeptionelle Veränderung mit sich bringen würde. Aber eine Veränderung nach nicht ganz einem Jahrzehnt war notwendig. 1988 übernahmen neue Frauen den Verein und Erikas Eule der Weisheit wurde zum neuen Logo.
Cornelia: Vielen Dank für das Interview!
Helga: Gerne!